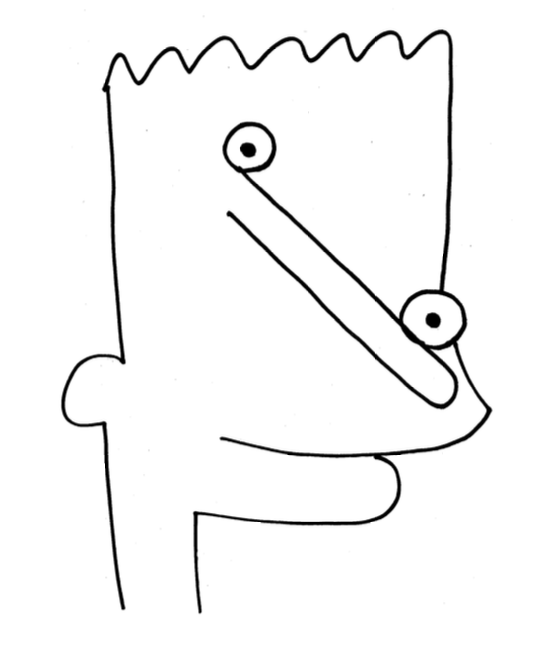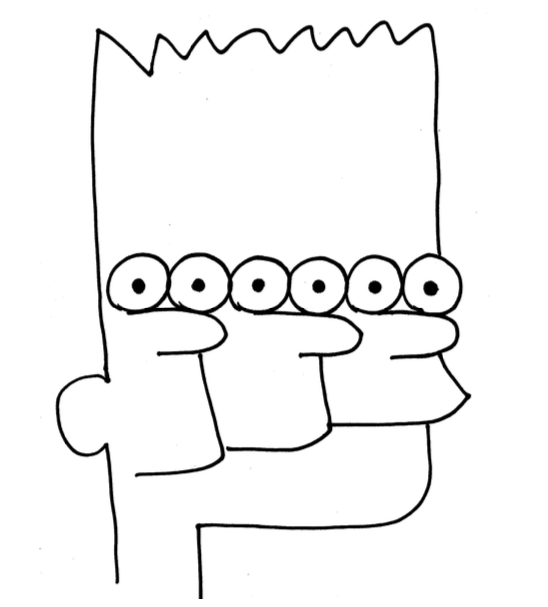Wahrlich seltsame Momente erlebten die katholischen Priester, die im Jahr 1584 nach Mons im heutigen Belgien geeilt waren. Im Kloster der Soeurs Noires hatten sie sich um die Dominikanernonne Jeanne Fery versammelt, deren seltsames Gebaren sie während ihres Besuchs entschlüsseln wollten. Die 25-Jährige sprach wie ein Kind mit den Priestern. Dann wieder kam aus ihrem Mund die tiefe Stimme eines Dämons namens Sanguinaire, der Stücke des Fleisches der Frau verlangte. An anderen Tagen diskutierten die Priester mit einer Kreatur, die sich „Garga“ nannte und die behauptete, sie wolle Schwester Jeanne vor Schmerzen schützen – sie aber auch zu Versuchen animierte, sich selbst den Hals aufzuschlitzen. Und ab und zu übernahm noch eine ältere Frau namens Maria Magdalena, die gemeinsam mit den Besuchern besonnen nach Heilung für Jeanne suchte. Manchmal hörten die Priester sogar, wie all diese unterschiedlichen Wesen im Körper der Nonne miteinander stritten.
Die gebeutelte Jeanne Fery war natürlich nicht vom Teufel besessen, wie die Priester schnell diagnostiziert hatten. Man vermutet: Es war eine der ersten Beschreibungen einer seltenen Krankheit. Die ist so unglaublich, dass viele immer noch an ihrer Existenz zweifeln, und sie ist auch heute noch nicht bis ins letzte Detail verstanden: die Dissoziative Identitätsstörung – früher auch Multiple Persönlichkeitsstörung genannt. Schwester Jeanne war nicht eine Person, sondern viele.
Eigene Vorlieben, Fähigkeiten, Krankheiten
Vielfältig, das sind wir alle mehr oder weniger. Tagsüber vielleicht tough im Job, abends einfühlsam gegenüber der besten Freundin. Unter der Woche unwirsch und barsch, am Wochenende in Tränen aufgelöst, weil der eigene Fußballverein eine Niederlage kassiert. Doch normalerweise haben Menschen dabei stets ein kohärentes Selbstbild, und sie sind sich jeder der Rollen bewusst, die sie gerade innehaben.
Bei einer Dissoziativen Identitätsstörung (DIS) dagegen übernehmen zwei oder mehr Persönlichkeiten abwechselnd, unwillkürlich, plötzlich und vollständig die Kontrolle über das Denken, Fühlen und Handeln eines Menschen. Diese Persönlichkeiten sind nicht einfach nur unterschiedliche Charakterfacetten, sondern eigenständige und vielschichtige Identitäten mit eigenem Ich-Gefühl. Das heißt: Es existiert jeweils ein eigenes Alter und Geschlecht, ein eigener Stil, eigene Vorlieben, Eigenschaften, Ansichten und Fähigkeiten. Sogar unterschiedliche Krankheiten bringen die Persönlichkeiten mitunter mit.
Viele Betroffene sprechen von sich selbst als „System“. Darin tritt eine Hauptpersönlichkeit als „Host“ auf, also als Gastgeber oder Gastgeberin, der oder die den größten Teil der Zeit für den Körper verantwortlich ist. Der Host ist für den Alltag zuständig. Bei den behandelnden Ärzten gilt er oft als „Anscheinend Normaler Persönlichkeitsanteil“. Er übernimmt das Ruder, wenn es um Schule, Arbeit, Haushalt oder Behördengänge geht, ist vor allem rational und zeigt kaum oder keine Gefühle. Um den Host herum gesellen sich weitere, sogenannte „Emotionale Persönlichkeitsanteile“, die gefühlsbetonter, irrationaler und oft auch instabiler sind. Häufig ist darunter mindestens ein Kind. Andere Persönlichkeiten wiederum treten als selbstbewusste junge Männer auf und agieren als Beschützer des „Systems“. Manchmal wissen diese unterschiedlichen Innenpersonen, dass sie sich einen Körper mit anderen teilen, manchmal auch nicht.
Das Umschalten zwischen den Persönlichkeiten ist für Außenstehende nicht immer zu bemerken. Wenn doch, wirkt es, als würde schlagartig ein anderes Wesen die Kontrolle über den Körper übernehmen. Die Betroffenen gestikulieren plötzlich anders, gehen anders, sprechen anders. Oft ändert sich sogar die Handschrift.
Plötzliches Umschalten
Das Umschalten zwischen einzelnen Persönlichkeiten wird ausgelöst durch Trigger – das können bestimmte Gegenstände, Situationen oder Gerüche sein. Und die hängen überwiegend damit zusammen, was die Medizin heute als häufigste Ursache für eine Dissoziative Identitätsstörung ausgemacht hat: Fast immer stecken hinter diesen abrupten Persönlichkeitswechseln emotionale Vernachlässigung, brutale Misshandlungen, Folter oder Kriegserlebnisse in der frühesten Kindheit. Oft auch schwerer Kindesmissbrauch über längere Zeit, manchmal systematisch von Kriminellen oder rituell von Sekten ausgeübt. Auch Verluste von Bezugspersonen, etwa der überraschende Tod eines Elternteils, oder schwere Krankheiten sind als Auslöser bekannt.
Wenn ein Kind so etwas Schreckliches erlebt, ist es nicht so, dass die Seele daran zerbricht – sie kann erst gar nicht zusammenwachsen. Denn kleine Kinder besitzen noch keine integrierte Persönlichkeit. Und werden sie von einer wichtigen Bezugsperson absichtlich verletzt und gequält, stehen sie vor einem großen Dilemma: Sie wollen diesen Menschen einerseits lieben und andererseits mit aller Kraft vor ihm flüchten. Sie lösen es, indem sie das Unvorstellbare, das ihnen geschieht, einer anderen Person zuschreiben. Die Erfahrungen und Erinnerungen werden also sicher verpackt – in einer oder mehreren neuen Identitäten. Und weil dadurch die Schmerzen gelindert werden, verfestigt sich der Zustand mit zunehmendem Alter. Eine multiple Persönlichkeit ist also auch ein Schutzmechanismus, eine Überlebensstrategie.
Zerrissen zwischen den Bedürfnissen
Die Dissoziative Identitätsstörung ist selten, aber nicht sehr selten: Man schätzt, dass die Störung bei einem bis 1,5 Prozent aller Menschen auftritt. Einige von ihnen sind erfolgreich im Leben. Andere brauchen Pflegedienste und Tageseinrichtungen, um ihr Leben zu bewältigen. Denn die Betroffenen leiden fast immer an den Folgen ihrer Traumata, zum Bespiel an Panikanfällen und Essstörungen. Einige sind depressiv, andere alkohol- oder drogenabhängig. Viele fühlen sich entfremdet von ihrem Leben, sind zerrissen zwischen den Bedürfnissen ihrer unterschiedlichen Identitäten.
Und immer wieder finden sie sich in völlig unerklärlichen Situationen wieder: Sie entdecken zu Hause Zettel mit rätselhaften Botschaften in unbekannten Handschriften, stolpern in ihren Wohnungen über seltsame Gegenstände und fremde Möbel, sitzen plötzlich Menschen gegenüber, die sie nicht kennen. Denn viele „Innenpersonen“ wissen nicht, was die anderen vorher gerade getan haben. Manche Betroffene haben darum im Laufe ihres Lebens gelernt, schnell und unauffällig herauszufinden, wo sie sich gerade befinden und wer die Leute um sie herum eigentlich sind.
Ist es bei diesem Krankheitsbild überhaupt möglich, Menschen mit Dissoziativer Identitätsstörung juristisch für kriminelle Handlungen haftbar zu machen? Der US-amerikanische Football-Spieler Herschel Walker, der 2022 im US-Bundesstaat Georgia für die Republikaner in den Senat einziehen wollte, schob beispielsweise häusliche Gewalt gegen seine damalige Frau auf seine alternativen Identitäten. 20 Jahre zuvor war bei Walker DIS diagnostiziert worden, 2008 hatte er ein Buch über seine Krankheit veröffentlicht. Ob jemand wirklich betroffen ist oder nur eine gute Ausrede sucht, ist für Gerichte schwer festzustellen.
Sicher ist: Bösartige Ichs sind fast immer Schauermärchen. Schon „Besessene“ im Mittelalter hatten natürlich nicht den Satan im Leib. In der Neuzeit ersann E. T. A. Hoffmann für seine Novelle „Das Fräulein von Scuderi“ (1819) die Figur des René Cardillac, gleichzeitig ein angesehener Goldschmied und ein brutaler Mörder – und vermutlich einer der ersten Literaturbösewichte mit DIS. Am bekanntesten ist wohl Dr. Jekyll beziehungsweise Mr. Hyde, den sich der schottische Schriftsteller Robert Louis Stevenson 1886 ausgedacht hat. Und auch der Hollywood-Film „Fight Club“ war mit dem Motiv des dunklen zweiten Ichs 1999 erfolgreich an den Kinokassen. Im normalen Leben gibt es Serienmörder mit Dissoziativer Identitätsstörung dagegen vermutlich nicht häufiger als solche ohne.
Modewellen und Backlashs
Seit die Identitätsstörung im 19. Jahrhundert als „dédoublement“ zum ersten Mal ansatzweise beschrieben wurde, gab es immer wieder Phasen, in denen das Interesse daran groß war. Mal war sie eine Modekrankheit – dann wieder wuchs das Misstrauen gegenüber Kranken. Den größten Bärendienst in jüngerer Vergangenheit hat den Betroffenen das 1973 erschienene Sachbuch „Sibyl“ geleistet. Die spektakuläre Fallschilderung (Untertitel: „The True Story of a Woman Possessed by 16 Separate Personalities“) wurde in den USA zum Bestseller und löste in den 1980ern eine Welle von Diagnosen aus. Es gab Berichte über Erkrankte mit angeblich mehr als 4.000 Innenpersonen oder Menschen, die Tierpersönlichkeiten in sich spüren wollten. Ende der Neunziger kam heraus: Die Patientin „Sibyl“ war manipuliert und die Geschichte von den Autorinnen aufgebauscht worden.
Inzwischen wird die Störung sachlicher diskutiert, sie steht in offiziellen Krankheitskatalogen wie dem ICD-11, und Forschende haben sie mit Hirnscans unzweifelhaft nachgewiesen: Nach einem Persönlichkeitswechsel werden bei DIS-Betroffenen unterschiedliche neuronale Netzwerke aktiv. Blutdruck, Muskelspannung oder sogar die Sehschärfe verändern sich schlagartig.
Immerhin: Heute kann vielen Dissoziierten zumindest begrenzt geholfen werden. Ärztinnen und Psychologen versuchen zunächst, das zugrundeliegende Trauma aufzuarbeiten, um die Menschen zu stabilisieren. Und bauen dann Brücken zwischen den Innenpersonen. Die sollen anfangen, miteinander zu kommunizieren, voneinander zu lernen und sich aufeinander zu beziehen. Natürlich sind dabei auch Verhandlungsgeschick und Kompromissbereitschaft gefragt, schließlich müssen ja mitunter sehr unterschiedliche Persönlichkeiten zusammenarbeiten. Ziel ist es aber nicht, mehrere Identitäten zu einer Persönlichkeit zu verschmelzen. Das würde die meisten Betroffenen wohl eher destabilisieren. „Viele geworden zu sein, ist keine Krankheit, sondern eine Anpassungsleistung in einer gewaltvollen Realität, die sonst nicht überlebbar wäre“, erklärt der DIS-Verein Vielfalt e.V.. Stattdessen sollen Betroffene die Wechsel besser kontrollieren lernen, Trigger möglichst vermeiden – und letztlich einen tragfähigen Kompromiss finden, der ihnen möglichst viel Lebensqualität beschert. Denn immer noch ist die Störung für die meisten ein Stigma, und die Menschen tun fast alles, um es zu verbergen.
Aber es gibt auch eine selbstbewusstere Haltung: Manche Kranke lehnen den Begriff „Störung“ ab und bevorzugen den Ausdruck „Dissoziative Identitätsstruktur“. Sie betonen stolz ihre „Multiplizität“, nennen Menschen mit kohärentem Selbst „Singlets“ und verwahren sich dagegen, dass irgendeine ihrer Innenpersonen durch Therapie verschwinden könnte. Das, so argumentiert beispielsweise der australische Philosophieprofessor Timothy J. Bayne, sei schließlich die Eliminierung einer Person – und als solche ernsthaft amoralisch.