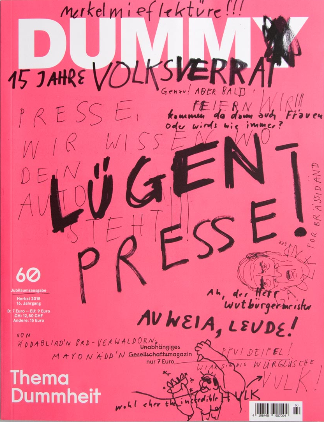Der Maler Gasztowt, der seinen Vornamen irgendwo in der Stadt verloren haben musste und der nun fiebrig auf der Suche nach irgendetwas war, trat ein. Das rumpelige Etablissement trug den verheißungsvollen Namen „Zur wilden Marderkatze“, und hinter der grünen Laterne an der Hausfassade hatte Gasztowt einst Nächte mit Fremden verbracht, „im heißen Bemühen, sich in den tiefsten Grund der Seelen dieser geheimnisvollen Menschen hineinzubohren“. An diesem Tag spielte dort ein junger Mann auf einer Geige, neben ihm kauernd ein Mädchen, das ihn auf einer Harfe begleitete. Die Musik der beiden fesselte Gasztowt. „Ein anderes Mal hätte sie ihn zur Verzweiflung gebracht. Heute war sie für ihn ein Labsal und ein Hochgenuss.“ Denn diese Musik war banal, geist- und hirnlos.
Mit seinem 1918 auf Deutsch erschienenen Roman „Der Schrei“ setzte der polnische Schriftsteller Stanislaw Przybyszewski seiner wilden Zeit in Berlin ein Denkmal. Sein Protagonist Gasztowt lauschte in der „Wilden Marderkatze“ hingebungsvoll stumpfsinnigster Musik. „Man muss nur verstehen zuzuhören“, dachte der Maler tief befriedigt, „und dann wird selbst die blödeste, höllisch dumme Melodie zu einer unerhört tiefen und betörenden Offenbarung – und das Herrlichste an dieser Musik, das ist eben, dass sie die düsterste Stimmung in taumelnde Sorglosigkeit umwandelt, den erbärmlichen, flennenden Menschenjammer mit einer breiten, herrischen Geste abtut und mit verächtlichem Hohne dem Leben in seine infame Fratze speit.“ Gasztowt nahm einen tüchtigen Schluck, zündete sich eine Zigarette an und war allerbester Dinge.
Man könnte den Getriebenen aus „Der Schrei“ einen Connaisseur des Dumpfen nennen. Mindestens aber jemanden, der wusste, welche Musik er wann brauchte. Jedes Musikstück besteht zu einem gewissen Anteil aus intellektuellen Reizen, Futter für den Kopf also, sowie aus Reizen, die unmittelbar auf den Bauch und darunter liegende Körperregionen zielen. Und wenn der Kopf zu viel Futter bekommen hat und die Herrschaft ganz an sich reißen will, dann braucht es eben manchmal eine handfeste Dosis Primärreiz. Dann muss es krachen. „Mach deinen Verstand frei, dann wird dein Arsch schon folgen“, konstatierte die um keine Direktheit verlegene Funkband Parliament einst. Die Musik für solche Lockerungsübungen ist nicht wirklich dumm, denn die Musiker haben ja gewieft genau das angepeilt. Aber eben mitunter roh, dumpf, laut, monoton, repetitiv. Wohltuend primitiv.
Wop bop a loo bop a lop bom bom!
„Primitiv“ bedeutet „das erste seiner Art“. Haben also die Steinzeitmenschen damit angefangen, die vermeintlich bei ekstatischem Baumstumpfgetrommel ihre noch kleinen Gehirne auf Pause schalteten? Nein, sie sind unschuldig, sie spielten vermutlich eher zartfühlend leiernde Melodien auf Knochenflöten. Doch vielleicht zu Beginn des 20. Jahrhunderts ging es los, als im Mississippi-Delta erstmals Blues-Musiker zyklisch sich wiederholende Akkorde geklampft und dazu geknurrt und geheult haben, um Geister zu beschwören und Elend zu vergessen. Spätestens aber, als pomadisierte Halbstarke zu Bill Haleys eher eindimensionalem „Rock Around The Clock“, („One, two, three o’clock, four o’clock rock“) ab 1954 Inneneinrichtungen zerlegten, war die geile Dumpfheit ein Thema. Schon ein Jahr später brüllte der queere Siegelringträger Little Richard stark übersteuert „A wop bop a loo bop a lop bom bom!“. Das heißt das, was es heißt. Damit schalteten Little Richard und seine Zeitgenossen bereits zu Beginn der Popmusik jene Maschine aus, die sonst in Kultur stets Sinn produzieren will – und sei es nur der Sinn, dass gerade einer zum Städtele hinaus muss.
Sinnfreiheit, wunderbare Sinnfreiheit. Darüber konnte sich ein kleiner, kluger, kritischer Mann im Anzug trefflich aufregen: Theodor W. Adorno veröffentlichte schon 1936 unter dem bissigen Pseudonym „Hektor Rottweiler“ in der Zeitschrift für Sozialforschung eine legendäre Abrechnung mit dem aufkommenden Jazz, der damals noch vorwiegend aus vergleichsweise bravem Dixieland und Swing bestand. In dieser rhythmischen, repetitiven, mithin warenförmigen Musik vermeinte Adorno die Disziplinierung durch die kapitalistischen Arbeitsverhältnisse und die fordistische Mobilmachung zu erkennen. Später machte er sich lustig über „die grölende Gefolgschaft des Elvis Presley“.
Vermutlich hat es Adorno vor einem Herzinfarkt bewahrt, dass er die Monks nicht kannte. Das waren fünf ehemalige GIs, die in Deutschland gestrandet und dann 1964 von zwei deutschen Werbeprofis zu „Anti-Beatles“ umgestaltet wurden. Ihr Outfit: Mönchskutten und Mönchstonsuren. Ihre Musik: radikal monotone Beatmusik, mit finsteren Texten („I hate you“) ohne Refrains, in körperverletzender Lautstärke. Der Monks-Bassist beschrieb später den Entstehungsprozess der Musik so: „Wir haben acht Akkorde. Können wir daraus zwei machen? Oder vielleicht nur einen? Und wie viele Wörter haben wir in der Strophe? 15? Können wir daraus drei machen?“ Visionär.
Mit ihrem monotonen Krach legten die Monks eine der Grundlagen für Garage und Punk – beides Genres, die oft in absichtlich schlechter Klangqualität und unter Vermeidung von allzu viel musikalischem Können auftraten, dafür aber mit reichlich Haltung. Ein gutes Beispiel: die 1964 gegründete Detroiter Polter-Polit-Rockband MC5, über deren erstes Album Kritiker lästerten, dass darauf rohe Gewalt wohl ein Ersatz für Originalität sein solle. Es ist natürlich eine grandiose Platte. Oder ihre Freunde von den Stooges, die ihre Musik durch den tatkräftigen Einsatz von Staubsaugern in stoische Rhythmusübungen zerlegten, über die Sänger Iggy Pop dann endlos Zeilen wie „I wanna be your dog“ deklamierte. Live klang das Zeitzeugen zufolge, als lande ein Flugzeug mitten im Zimmer. Ein Befreiungsschlag inmitten von zunehmend barock werdender Popmusik. So kam die Sinnmaschine wieder knirschend zum Stillstand.
’Cause we dig
’Cause we dig
We dig
We dig repetition
We dig repetition
We dig repetition in the music
And we’re never going to lose it.
All you daughters and sons
Who are sick of fancy music
We dig repetition
Repetition in the drums
And we’re never going to lose it.
Das sang die Postpunk-Band The Fall 1978. Den monoton leiernden Gesang von Frontmann Mark E. Smith beschrieb der Popkritiker Simon Reynolds mal als „Eine-Noten-Darbietung irgendwo zwischen amphetaminbefeuerter Tirade und alkoholdummem Seemannsgarn“. Das Lied „Repetition“ war so etwas wie The Falls musikalisches Manifest, von dem sie in ihrer mehr als 30-jährigen Laufbahn nie mehr abrücken sollten. Noch konsequenter in Sachen Wiederholung war die Blues-Hardrock-Band AC/DC, die eine ganze Superstarkarriere darauf aufbaute, dass sie quasi immer denselben Song spielte, wenn auch mit unterschiedlichen Titeln. Und auch die Deutschen, die sich in den Sechzigern und Siebzigern mit Taschen voller Drogen auf die Suche nach einer Rockmusik abseits der angloamerikanischen Kultur machten und deren Musik später „Krautrock“ genannt werden sollte, steckten viel Intelligenz in die Wiederholung, die Wiederholung, die Wiederholung.
Techno trieb den Stumpfsinn auf die Spitze
Eine ihrer Entdeckungen: Wenn man es stoisch wiederholt, hört sich irgendwann jedes Türknallen, jedes Geschirrscheppern an wie Musik. Das Bewusstsein fängt an, Muster zu erkennen. Und das lohnt sich. Dem portugiesischen Biomediziner Carlos Silva Pereira zufolge genießt es das menschliche Gehirn, wenn es weiß, was in Musik als nächstes kommen wird. In seiner 2011 veröffentlichten Studie mit dem Titel „Music and Emotions in the Brain: Familiarity Matters“ schreibt Pereira: „Vertrautheit scheint der entscheidende Faktor zu sein, um Hörer emotional in Musik eintauchen zu lassen.“ Und das gilt nicht nur für wieder und wieder abgenudelte Pophits im Formatradio, sondern auch für sich wiederholende Elemente in den Liedern selbst: Akkorde, Sampleloops, eine einzelne Textzeile.
Kein Wunder also, dass heute immer größere Teile der populären Musik jeden intellektuellen Ballast freudig über Bord werfen: Je stumpfsinniger ein Lied ist, desto mehr Leute erkennen es wieder und desto erfolgreicher wird es. Der spanische Künstliche-Intelligenz-Forscher Joan Serrà hat Beweise. Er hat 500.000 Popstücke von 1955, als Little Richard „A wop bop a loo bop a lop bom bom!“ brüllte, bis 2010 auf ihre tonalen, melodischen und textlichen Inhalte untersucht – und dabei kurz gesagt heraufgefunden, dass populäre Musik immer weniger komplex und dafür immer monotoner und repetitiver wird. Der Kopf will halt Pausen im modernen Leben.
Die meiste Popmusik bewegt sich damit inzwischen in Richtung eines Genres, das die großartig stumpfsinnige Wiederholung bereits ab Ende der 1980er auf die Spitze trieb: Techno. Diese Musik wiederholt einfach stoisch immer dasselbe Klangelement, bis es funky wird und Zuhörer mit sehr freiem Kopf zu tanzen beginnen (wenn sie nicht vorher schon genervt den Raum verlassen haben). Dieses Prinzip haben allerdings nicht Technoproduzenten erfunden. Schon James Brown hatte sein Stück „Sex Machine“ aus gerade mal zwei Akkorden aufgebaut, die fast ohne jede Variation endlos, so schien es, über denselben Beat liefen. Und das ist der Punkt von Funk oder Techno: dass Hörer und Tänzer ihr Bewusstsein im allumfassenden, ewig währenden Groove auflösen. Dem Surrealisten Georges Bataille zufolge ist genau solche komplette Auflösung des Selbst das Heilige, Transzendente. Der reine Stumpfsinn – er kann also auch zur Erleuchtung führen.